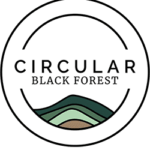Vom Überlebensmodus zur emotionalen Evolution – Bei Schäfer Kunststofftechnik steht Menschlichkeit am Anfang jeder zirkulären Innovation
Schäfer Kunststofftechnik aus Ortenberg entwickelt und produziert hochpräzise Kunststoffbauteile – vom Einzelteil bis zur Baugruppe, vom Maschinenbau bis zur Medizintechnik. Doch für Geschäftsführer Joachim Schäfer ist klar: Wirtschaft darf sich nicht allein an Effizienz orientieren – sondern muss Teil der Lösung sein. Gemeinsam mit Ulrich Müller, Leitung Projekte und Nachhaltigkeit, denkt er die Rolle des Unternehmens neu.
Wer bei Schäfer Kunststofftechnik heute über zirkuläre Transformation spricht, meint damit mehr als nur Materialwahl oder Produktdesign – es geht um einen kulturellen Wandel, der tief im Unternehmen verankert ist. Nach einer wirtschaftlich schwierigen Phase inklusive Insolvenz hat sich das mittelständische Unternehmen neu aufgestellt. Heute verfolgt Schäfer Kunststofftechnik einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz – mit konkreten Projekten, experimentellen Formaten und dem Willen, über den Tellerrand hinauszudenken.
Schäfer Kunststofftechnik ist ein mittelständisches Unternehmen mit rund 95 Mitarbeitenden. Was zeichnet das Unternehmen aus – und was treibt es an?
Joachim Schäfer: Unser Unternehmen hat eine sehr besondere Entwicklung durchlaufen. Nach einer existenzbedrohenden Insolvenz habe ich persönlich einen radikalen Wandel angestoßen – weg von klassischen Hierarchien, hin zu einem Fokus auf Menschlichkeit und ganzheitliches Denken. Für uns ist klar: Wirtschaften muss wieder menschlicher werden. Das war für mich nach einer persönlichen und unternehmerischen Krise der Wendepunkt – aus der heraus sich unser Unternehmen grundlegend verändert hat. Wir setzen auf eine Unternehmenskultur, in der der Mensch und die Natur im Mittelpunkt stehen. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist, aber ich bin überzeugt: Nur wenn wir Menschen aus dem Herzen heraus agieren und nicht aus Angst, entsteht wirklich nachhaltige Entwicklung. Heute setzen wir auf radikale Offenheit, Eigenverantwortung und Vertrauen. Hierarchie funktioniert für uns nicht mehr. Diese Haltung unterscheidet uns von vielen anderen Unternehmen.
Ulrich Müller: Gleichzeitig sind wir sehr technologiegetrieben – mit 12.000 Produkten im Portfolio und Kunden weltweit. Uns geht es darum, nicht nur effizient zu arbeiten, sondern vor allem resilient und zukunftsorientiert. Dazu gehört auch, unsere gesamte Produktion laufend auf Nachhaltigkeit zu prüfen – von der Energieversorgung bis zur Werkstoffwahl.
Wachstum durch Menschlichkeit und ganzheitliches Denken. Wir wollen nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern auch gesellschaftlich und ökologisch Verantwortung übernehmen.
JOACHIM SCHÄFER
Was bedeutet Circular Economy für Sie?
Joachim Schäfer: Das war ein natürlicher Prozess, der mit unserer Neuaufstellung nach der Insolvenz begann. Uns wurde klar: Nachhaltiges Wirtschaften ist nicht nur moralisch geboten, sondern auch ökonomisch sinnvoll. Ein zentrales Thema bei uns ist Wasser. Durch innovative Aufbereitungsanlagen sparen wir nicht nur Ressourcen, sondern reduzieren auch den Verbrauch von Kühlschmiermitteln und Frischwasser erheblich. Das war unser Einstieg in zirkuläres Denken, das wir seither auf viele Bereiche ausgeweitet haben. Unsere Produktionsspäne aus Kunststoff landen derzeit noch in der Verbrennung – aber wir arbeiten daran, sie künftig wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Das Abwasser unserer Osmoseanlage, das durch die notwendige Spülung der Membranen entsteht, führen wir einer weiteren Verwendung zu. Über eine speziell installierte Zisterne gelangt dieses Wasser über die Toilettenspülung in die Kanalisation. Und wir betreiben unsere E-Fahrzeugflotte mit Strom aus der firmeneigenen Photovoltaikanlage.
Ulrich Müller: Wir verfolgen einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz – seit über sechs Jahren wirtschaften wir klimaneutral in Scope 1 und 2 und aktualisieren unsere CO₂-Bilanz regelmäßig. Unser Ziel ist es, bis spätestens 2035 vollständig emissionsfrei in diesen Bereichen zu sein. Inzwischen haben wir bereits über 80 % unserer Emissionen eingespart. Dazu tragen zahlreiche Maßnahmen bei: Wir haben den gesamten Firmenfuhrpark auf Elektromobilität umgestellt, nutzen Solarenergie und setzen auf eigene Energiespeicher. Unsere neue, energieeffiziente Absauganlage spart jährlich rund 100.000 kWh Strom. Kunststofföfen wurden von Erdgas auf Flüssiggas umgerüstet, und wir recyceln jährlich 75 bis 90 Tonnen Kunststoff. Hinzu kommen intelligente Lüftungssysteme und eine eigene Infrastruktur zur Wasseraufbereitung.
Für uns heißt Circular Economy aber auch: Verantwortung übernehmen. Nicht nur liefern, was bestellt wird, sondern sich ehrlich fragen: Was machen wir da eigentlich? Wie gehen wir mit Ressourcen um? Unternehmen müssen ihren Fußabdruck kennen – und ihre Rolle nutzen, um aktiv zur Veränderung beizutragen.
Schäfer Kunststofftechnik ist Teil des Projekts RegioFab – was steckt dahinter?
Joachim Schäfer: RegioFab ist ein noch junges Projekt, das Anfang des Jahres gestartet ist und auf drei Jahre angelegt ist. RegioFab steht für „regionale Fabrikation“. Der Impuls kam von der Hochschule Karlsruhe, konkret von Professor Kinkel, der damals unseren Maschinenbauingenieur Cédric Schwerdtfeger angesprochen hat. Die Hochschule hat uns eingeladen, Teil dieses neuen Projekts zu werden. Obwohl wir zu Beginn nicht genau wussten, worauf wir uns einlassen, haben wir zugesagt – aus Überzeugung und Neugier.
Ulrich Müller: RegioFab verfolgt das Ziel, regionale Wertschöpfung durch gemeinsames Fabrik-Sharing resilienter und nachhaltiger zu gestalten – also zu prüfen, wie sich Prozesse, Maschinen, Infrastruktur oder auch Know-how unter KMU und Startups in einer Region besser teilen lassen. Aktuell sind vier produzierende Unternehmen beteiligt – darunter ein 3D-Druck-Betrieb, Spezialisten für Fasertechnik, ein Formenbauer und wir von Schäfer Kunststofftechnik. Dazu kommen der Logistikdienstleister 4flow aus Berlin, die Hochschule Karlsruhe als Koordinatorin und die TU München als Forschungspartnerin.
Joachim Schäfer: Die Zusammenarbeit findet in sogenannten Use Cases statt – aktuell gibt es drei. Jeder Use Case adressiert eine konkrete Herausforderung. In unserem Fall geht es um die Produktionssteuerung. Wir bringen hier unsere eigene App ein, die wir seit Jahren intern entwickeln. Sie ermöglicht eine strukturierte, digital unterstützte Montage und Prozessdokumentation. Aktuell testen wir sie im Live-Betrieb, parallel zum bestehenden ERP-System. Langfristig ist das Ziel, die App so weiterzuentwickeln, dass auch andere Unternehmen aus dem Netzwerk sie nutzen können.
Ulrich Müller: Genau das macht RegioFab so spannend: Wir entwickeln Lösungen aus der Praxis für die Praxis. Jeder bringt seine Stärken ein – und wir lernen voneinander. Besonders interessant wird es, wenn sich daraus unerwartete Synergien ergeben. Vielleicht ist unsere App ja auch in ganz anderen Produktionskontexten einsetzbar – das wird sich im Laufe des Projekts zeigen.
Joachim Schäfer: Insgesamt laufen in Baden-Württemberg derzeit sieben bis acht Projekte in einem ähnlichen Kontext. Und für uns ist klar: Solche Netzwerke sind ein Schlüssel für zirkuläre Transformation – gerade im industriellen Mittelstand. Es geht darum, neue Berührungspunkte zu schaffen, voneinander zu lernen und gemeinsam auszuprobieren, was möglich ist.
Wie arbeiten Sie heute schon mit Partnern zusammen – und was wünschen Sie sich?
Joachim Schäfer: Kooperation braucht Vertrauen. Wir legen deshalb großen Wert auf Offenheit – sowohl gegenüber unseren Kunden als auch gegenüber unseren Lieferanten. Bei uns heißt das: Wir teilen alle relevanten Informationen – Stücklisten, Abläufe, Preise. Das mag untypisch wirken, sorgt aber für Effizienz und spart Kontrolle. Nach unserer Erfolgsinsolvenz haben wir beispielsweise alle Lieferanten zu 100 Prozent bezahlt – auch aus Überzeugung, denn niemand sollte zu Schaden kommen. Das hat Vertrauen geschaffen – und Vertrauen ist die Grundlage für echte Partnerschaft. Ich wünsche mir, dass noch mehr Unternehmen bereit sind, diesen Weg der Offenheit mitzugehen. Nicht nur in stabilen Zeiten, sondern gerade dann, wenn es darauf ankommt.
Ulrich Müller: Ein ganz praktisches Beispiel für unsere Zusammenarbeit mit Partnern ist die Materialeingangs- und -ausgangsprüfung: Wir haben mit unseren Kunden vereinbart, dass wir nicht nur die Qualität der angelieferten Materialien dokumentieren, sondern auch die Ergebnisse der Endkontrolle offenlegen. Das bedeutet, dass unsere Kunden jederzeit Einblick in die Qualitätsdaten ihrer Produkte erhalten – von der Wareneingangsprüfung bis zur Endabnahme. Diese Transparenz sorgt dafür, dass eventuelle Fehlerquellen frühzeitig erkannt und gemeinsam gelöst werden können. Gleichzeitig ermöglicht uns dieser offene Austausch, Prozesse gemeinsam mit unseren Partnern zu optimieren und die Qualität kontinuierlich zu verbessern. Auch die regionale Nähe ist ein großer Vorteil: Kurze Wege, persönlicher Kontakt und ein gemeinsames Verständnis für die Herausforderungen vor Ort erleichtern die Zusammenarbeit enorm.
Wo sehen Sie Hebel für mehr Circular Economy?
Joachim Schäfer: Die größte Herausforderung ist sicherlich, bestehende Denkmuster und Besitzansprüche zu überwinden. Es braucht Vertrauen und die Bereitschaft, Wissen und Ressourcen zu teilen. Ein Beispiel: Wir liefern Plexiglas-Bauteile bis nach China – das Rohmaterial kommt aber womöglich genau von dort. Das ist weder effizient noch nachhaltig. Die Idee wäre also: Warum nicht unser Know-how teilen, lokal produzieren lassen – und damit Ressourcen, Energie und unnötige Transporte sparen? Aber dafür braucht es neue Geschäftsmodelle. Und vor allem: ein anderes Denken. Weg vom klassischen Produzentenverständnis hin zu einem systemischen Blick auf Zusammenarbeit und Wertschöpfung.
Ulrich Müller: Dabei rücken auch Themen wie Scope-3-Emissionen stärker in den Fokus – also Emissionen, die in vor- oder nachgelagerten Prozessen entstehen und bislang schwer zu greifen sind. Wir wollen in Zukunft besser verstehen, wo unsere Materialien herkommen und wo sie letztlich landen. Genau hier kommt Plattformen wie Ecovadis eine wichtige Rolle zu: Sie helfen uns, mehr Transparenz in die Lieferkette zu bringen – zumindest ein Stück weit. Das funktioniert über standardisierte Fragebögen und Bewertungen zu Umweltstandards, Sozialkriterien und Governance. Inzwischen verlangen viele große Kunden eine Ecovadis-Zertifizierung von ihren Lieferanten.
Circular Economy heißt für uns, Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Prozesse zu übernehmen.
ULRICH MÜLLER
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Joachim Schäfer: Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir als Unternehmen nicht nur technologisch weiter vorne bleiben, sondern dass wir Kreisläufe ganzheitlich schließen – wirtschaftlich, ökologisch und vor allem menschlich. Mein persönlicher Traum ist es, vielleicht irgendwann ein Seminarhaus am See zu eröffnen, in dem wir unsere Erfahrungen weitergeben können. Doch was mich besonders antreibt, ist der Gedanke, mit unseren Produkten einen echten Unterschied zu machen – etwa in der Medizin. Unsere Kunststoffteile kommen in Geräten zum Einsatz, die bei der Strahlentherapie zur exakten Kalibrierung der Anlagen verwendet werden. Dadurch werden die Messergebnisse bzw. Bilder der Computertomographen sowie auch die Bestrahlungsgröße und exakte Ortung so präzise wie möglich erreicht. Damit tragen wir dazu bei, dass Tumore gezielter bestrahlt und Menschen wirksam behandelt werden können. Das ist für mich der Inbegriff von Sinnhaftigkeit: Technologie, die nicht nur effizient ist, sondern dem Menschen dient.
Ich glaube, echte Transformation beginnt immer beim Menschen selbst. Wir müssen bereit sein, auch schwierige Themen anzuschauen und nicht davor wegzulaufen – so wie in der Medizin erst Heilung möglich wird, wenn man hinschaut, was wirklich schmerzt. Mein Wunsch ist, dass wir diese Haltung weitertragen: Kreislaufwirtschaft nicht nur als wirtschaftliches oder ökologisches Konzept zu denken, sondern als menschliche Evolution, die das Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft in den Mittelpunkt stellt.
Was braucht es auf Systemebene, um diese Transformation wirklich möglich zu machen?
Ulrich Müller: Was es auf Systemebene wirklich braucht, ist mehr Transparenz und echten Austausch zwischen den Akteuren. Das merken wir aktuell sehr deutlich in unserem Projekt RegioFab: Es reicht nicht, wenn jeder für sich arbeitet – wir müssen die Bereitschaft entwickeln, Wissen, Daten und auch Kapazitäten zu teilen. Dafür braucht es Plattformen, auf denen sichtbar wird, wer was macht, welche Kompetenzen und Projekte es gibt, und wo man sich gezielt vernetzen kann. Gerade im Schwarzwald steckt unglaublich viel Potenzial. Was oft noch fehlt, sind die richtigen Anknüpfungspunkte, um dieses Potenzial auch wirklich zu entfalten – und die passenden Verbindungen, um Akteure und Ideen wirksam zusammenzubringen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir die Angst vor Fehlern und Kontrollverlust ablegen müssen. Transformation gelingt nur, wenn wir offen sind für neue Wege und auch mal etwas ausprobieren, was vielleicht nicht sofort funktioniert. Es braucht Mut, alte Strukturen zu hinterfragen, neue Wege zu gehen – auch wenn nicht alles sofort funktioniert. Diese Offenheit ist entscheidend, um wirklich gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
Und schließlich braucht es gezielte Unterstützung von außen – durch Förderprogramme, die Innovationen und Kooperationen tatsächlich ermöglichen, statt nach starren Vorgaben zu funktionieren. Denn nur wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an einem Strang ziehen und bereit sind, Verantwortung zu teilen, kann die Transformation zur Circular Economy im industriellen Alltag gelingen.
„Kooperationen sind entscheidend, um Kreisläufe zu schließen und Innovationen voranzutreiben.“
JOACHIM SCHÄFER